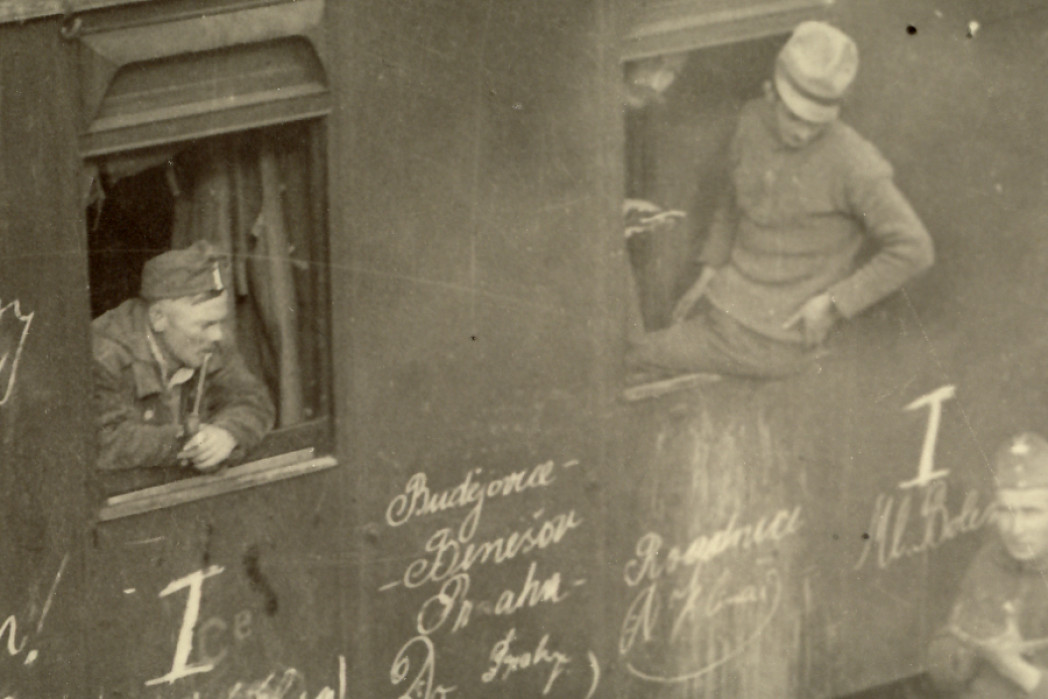
Dienststellen CC Regional History
24 Mai 2018 17:30-19:00
Die Beziehungen zwischen Italien und Österreich nach dem Ersten Weltkrieg
Der Bozner Historiker Andrea Di Michele referiert im Rahmen der Vorlesungsreihe "Zeitenwende 1918", organisiert vom Kompetenzzentrum für Regionalgeschichte
Dienststellen CC Regional History
Nach dem Ersten Weltkrieg kam es zu fundamentalen Veränderungen in den Beziehungen zwischen Italien und Österreich. Von der einstigen Großmacht war nur mehr ein kleiner Alpenstaat übrig, dessen politisches Gewicht sehr beschränkt war. Die beiden Nachbarstaaten hatten nach dem Krieg ein Interesse daran, die sie trennende „Erbfeindschaft“ mit Blick auf die konkreten beiderseitigen Interessen rasch zu überwinden. Italien wollte sein politisches und ökonomisches Gewicht in Österreich vergrößern, und der Alpenstaat diente dabei als eine Art Sprungbrett in Richtung Donauraum und Balkan, wo aufgrund des Zusammenbruchs der Habsburgermonarchie ein großes Machtvakuum entstanden war. Das sich in großen ökonomischen und politischen Schwierigkeiten befindliche Österreich hatte alles Interesse daran, gute Beziehungen zum benachbarten Siegerstaat und zukünftigen Partner vor allem auf wirtschaftlichem Gebiet zu unterhalten. Zudem einte die beiden Staaten das gemeinsame Interesse, die territorialen Ansprüche des neu entstandenen jugoslawischen Staates abzuwehren.
Neben diesen Faktoren, die zu einer Annäherung der beiden Staaten führten, stellte die Südtirolfrage ein Hindernis für die bilaterale Verständigung dar. Italien akzeptierte keine österreichische Einmischung in Fragen, die die Behandlung der Bevölkerung deutscher Muttersprache betrafen. Es praktizierte eine widersprüchliche Politik, die zwischen der Öffnung gegenüber einem Nachbarstaat, zu dem man freundschaftliche Beziehungen aufbauen wollte, und der gegensätzlichen Einforderung dessen, was man als „Rechte des Sieges“ bezeichnete, hin und hergerissen war.
Der Faschismus verschärfte diesen Widerspruch und lehnte die österreichischen Forderungen nach einer Mäßigung vehement ab. In Österreich wurde die Italianisierungspolitik in Südtirol mit großer Sorge beobachtet. Die entschiedenste Kritik gegen die Maßnahmen des Faschismus kam aus Innsbruck. Für die österreichische Regierung hingegen stellte es kein geringes Problem dar, auf der einen Seite die Zusammenarbeit mit Rom fortzusetzen und auf der anderen Seite die Forderungen nach einem Schutz der Südtiroler entsprechend zu berücksichtigen. Deshalb kam es im Laufe der 1920er Jahre zu einer ganzen Reihe von spannungsgeladenen Momenten zwischen den beiden Regierungen. Zusammenfassend kann man letztlich aber festhalten, dass die Südtirolfrage zwar einen stets präsenten Störfaktor darstellte, insgesamt aber wohl nicht ausreichte, um die bilateralen Beziehungen grundlegend zu erschüttern.